Nun möchte man natürlich wissen, ob Keynes fundamental psychologisches
Gesetz die Wirklichkeit auch trifft. Die beiden Variablen, die üblicherweise
für die empirische Prüfung herangezogen werden, sind das ![]() reale verfügbare
Einkommen der privaten Haushalte und der reale private Konsum. Die Beschränkung
auf den Konsum der privaten Haushalte erfolgt, da der staatliche Konsum nicht
mit dem
fundamental psychologischen Gesetz erklärt werden kann. Zwar wird auch für
den Staat ein Zusammenhang zwischen seinen Einnahmen und Konsumausgaben beobachtbar
sein - spöttisch könnte man sagen, dass er immer mehr ausgibt, als er einnimmt
-, aber Keynes Gesetz ist eindeutig auf das Konsumverhalten der privaten Wirtschaftssubjekte
gemünzt. Daher wird als erklärende Einkommensgröße nicht das
reale verfügbare
Einkommen der privaten Haushalte und der reale private Konsum. Die Beschränkung
auf den Konsum der privaten Haushalte erfolgt, da der staatliche Konsum nicht
mit dem
fundamental psychologischen Gesetz erklärt werden kann. Zwar wird auch für
den Staat ein Zusammenhang zwischen seinen Einnahmen und Konsumausgaben beobachtbar
sein - spöttisch könnte man sagen, dass er immer mehr ausgibt, als er einnimmt
-, aber Keynes Gesetz ist eindeutig auf das Konsumverhalten der privaten Wirtschaftssubjekte
gemünzt. Daher wird als erklärende Einkommensgröße nicht das ![]() BIP, sondern das
verfügbare Einkommen herangezogen.
BIP, sondern das
verfügbare Einkommen herangezogen.
In Abbildung 1 zeigt jeder Punkt eine Kombination von Einkommen
und Konsum der zehn Jahre von 1993 bis 2002 für Deutschland![]() in
Preisen von 1995. Die Entscheidung für reale Größen wird
in
Preisen von 1995. Die Entscheidung für reale Größen wird ![]() Annahme
stabiler Preise gerecht
und bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, dass sich die Haushalte im Konsumverhalten
nicht durch Schwankungen im Preisniveau beeinflussen lassen. Das bedeutet konkret,
dass die Haushalte ihre Konsumgewohnheiten bei der Umstellung von DM auf EUR
exakt beibehalten hätten, wenn tatsächlich alle Preise (und Löhne) im selben
Verhältnis (1,95583 : 1) umgerechnet worden wären.
Annahme
stabiler Preise gerecht
und bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, dass sich die Haushalte im Konsumverhalten
nicht durch Schwankungen im Preisniveau beeinflussen lassen. Das bedeutet konkret,
dass die Haushalte ihre Konsumgewohnheiten bei der Umstellung von DM auf EUR
exakt beibehalten hätten, wenn tatsächlich alle Preise (und Löhne) im selben
Verhältnis (1,95583 : 1) umgerechnet worden wären.
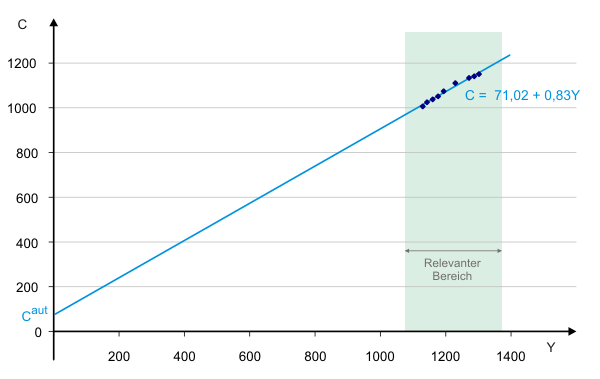
Konsumfunktion für Deutschland 1993-2002, Quelle: SVR Wirtschaft Tab. 35*, 39*, eig. Berechnungen; Erläuterungen s.Text. [maussensitive Grafik]
Man gewinnt aus Abbildung 1 unmittelbar den Eindruck, dass zwischen Einkommen und Konsum empirisch ein linearer Zusammenhang besteht. Zur Ermittlung der marginalen Konsumquote bietet sich die Methode der Kleinsten Quadrate an. Sie liefert folgende Schätzung für die Konsumfunktion:
[1] CHH = 71,02 + 0,83 Yv
Danach beträgt die marginale Konsumquote c in Deutschland 0,83. Von einem zusätzlichen Euro Einkommen geben die Bundesbürger im Schnitt also 83 Cent für den Konsum aus. Das wäre nach Keynes' Hypothese zu erwarten gewesen. Ähnliche Werte für die marginale Konsumquote schätzt man auch für andere Länder und andere Untersuchungszeiträume.
Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Konsum ist international und über die Zeit sehr stabil.
Die Methode der Kleinsten Quadrate und der Ausweis der geschätzten
Parameter mit zwei Nachkommastellen suggeriert allerdings eine nicht vorhandene
Genauigkeit. Mikroökonomisch trifft die unterstellte Kausalrichtung, dass das
Einkommen den Konsum determiniert, zweifelsfrei zu, makroökonomisch ist die
umgekehrte Richtung aber ebenso plausibel. Keynes' zentraler Hypothese zufolge
![]() ist ja der Konsum (=Nachfrage)
für die Produktion (=Einkommen) bestimmend.
Wenn sich Einkommen und Konsum gegenseitig beeinflussen, liefert die einfache
Regressionsschätzung der Konsumfunktion [1] aber verzerrte Schätzwerte.* Trotzdem
ist der Wert von ca. 0,8 für die marginale Konsumquote durchaus plausibel.
ist ja der Konsum (=Nachfrage)
für die Produktion (=Einkommen) bestimmend.
Wenn sich Einkommen und Konsum gegenseitig beeinflussen, liefert die einfache
Regressionsschätzung der Konsumfunktion [1] aber verzerrte Schätzwerte.* Trotzdem
ist der Wert von ca. 0,8 für die marginale Konsumquote durchaus plausibel.
Wir hätten auch einen anderen - direkteren -Weg einschlagen können, die keynesianische Einkommenshypothese zu testen. Für jedes Beobachtungsjahr halten wir die Veränderung des Einkommens und die Veränderung des Konsums fest. Abbildung 2 zeigt den zugehörigen Scatterplot.
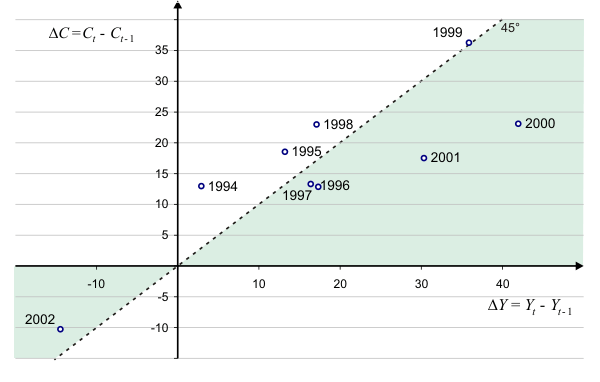
Einkommens- und Konsumänderungen sind positiv korreliert. Im grünen Bereich gilt das fundamental psychologische Gesetz, da dort die absolute Änderung des Konsums kleiner als die absolute Änderung des Einkommens ausfällt. Mitunter (1994, 95, 98) steigt der Konsum jedoch stärker als das Einkommen.
Zunächst finden wir auf den ersten Blick bestätigt, dass im Beobachtungszeitraum Einkommenssteigerungen mit Konsumsteigerungen einhergehen und der Rückgang der Einkommen in 2002 auch den Konsum hat sinken lassen. Allerdings unterstützt Abbildung 2 das fundamental psychologische Gesetz nur schwach. Denn in mehreren Jahren finden sich Konsumsteigerungen, die die Einkommenssteigerungen übertreffen.
Dennoch finden wir auch hier die keynesianische Einkommenshypothese im Großen und Ganzen bestätigt. Wir sind hier nämlich keinem naturwissenschaftlichen Gesetz auf der Spur, sondern einer ökonomischen Gesetzmäßigkeit, bei der Ausnahmen von der Regel durchaus zugelassen sind. Schließlich ist zu bedenken, dass das Einkommen zwar eine wesentliche Determinante des Konsums darstellt, aber keineswegs die einzige.
Die Schätzung der Konsumfunktion [1] liefert für den autonomen Konsum Caut einen Wert von ca. 71 Mrd. EUR. Dieser positive Achsenabschnitt scheint zunächst unsere theoretischen Vermutungen zu untermauern, dass die durchschnittliche Konsumquote mit steigendem Einkommen sinkt. Aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert nur zufällig positiv ist. Während sich Schätzungen für die marginale Konsumquote als sehr stabil erweisen, erhält man für den autonomen Konsum bei anders abgegrenzten Untersuchungszeiträumen durchaus auch negative Schätzwerte.*
In manchen Lehrbüchern - auch in empfehlenswerten - finden Sie den autonomen Konsum als Mindestversorgung der Bevölkerung erklärt. Auch wenn das Einkommen null sei, müsse man natürlich essen, wird argumentiert. Wie kann man aber Geld für Essen ausgeben, wenn man kein Einkommen hat? Na klar, es wird halt entspart!
Das ist eine Argumentation, die mikroökonomisch durchaus zutreffen mag. Wer kein Einkommen hat, kauft die lebensnotwendigen Güter, indem er entspart oder Kredit aufnimmt.
Makroökonomisch ist das reichlicher Unfug, den man auch mit einem Hinweis auf eine didaktische Vereinfachung nur schwer rechtfertigen kann. Wie Abbildung 1 erkennen lässt. liegt die deutsche Produktion eines Jahres in einer Größenordnung von über 1000 Mrd. EUR (mittlerweile in lfd. Preisen über 2000 Mrd. EUR). Ein Einkommen in Höhe von Null, d.h. keinerlei Produktion, wird es nicht geben. Falls doch, würde sich niemand mehr für Makroökonomie interessieren. Lange zuvor würden wir alle theoretischen Überlegungen vergessen, da wir bei einem realen Rückgang des Einkommens in erheblicher Größenordnung viel wichtigere Sorgen hätten. Denken Sie doch einmal darüber nach, wie stark das Einkommen fallen müsste, so dass mit bürgerkriegsähnlichen Unruhen zu rechnen wäre. Das macht sicherlich klar, dass wir an eine Situation, in der das Einkommen null ist, keinen ernsthaften Gedanken verschwenden müssen.
Caut ist also eine rein theoretische Größe. Sie bestimmt, die Lage (Höhe) der keynesianischen Konsumfunktion im Ausgaben-Einkommen-Diagramm und fängt damit verschiedene Einflüsse ein, die auf den Konsum wirken. Ändert sich das Einkommen, dann bewegen wir uns auf der Konsumfunktion. Ändern sich Daten des Modells (Rahmenbedingungen), so führt das zu einer Verlagerung der Konsumfunktion. Würde es z.B. in der Bevölkerung zu einem positiven Stimmungsumschwung kommen, weil der Kanzler rosige Zeiten verspricht und die Menschen es glauben (na gut, nicht gerade ein überzeugendes Beispiel), dann würde sich das in einem höheren autonomen Konsum niederschlagen. Die Konsumfunktion würde sich nach oben verlagern. Auch ein Einfluss auf die marginale Konsumneigung wäre denkbar.
Wenn Sie die Maus über ![]() Abbildung
1 stellen, können Sie sehen,
wie sensitiv der autonome Konsum auf Änderungen der Daten reagiert. Dazu wird
ein Fehler bei der Datenerfassung simuliert: Anstelle des korrekten Wertes
1151 Mrd. EUR für den Konsum in 2001 wird ein Wert von 1181 Mrd. EUR angenommen
(roter Datenpunkt). Infolge der großen Hebelwirkung durch die weite Entfernung
des Ursprungs vom relevanten Bereich kommt es zu einem negativen autonomen
Konsum. Nach wie vor behielte Keynes' Feststellung, dass der Konsum mit dem
Einkommen steigt, allerdings schwächer als dieses, dennoch Gültigkeit.
Abbildung
1 stellen, können Sie sehen,
wie sensitiv der autonome Konsum auf Änderungen der Daten reagiert. Dazu wird
ein Fehler bei der Datenerfassung simuliert: Anstelle des korrekten Wertes
1151 Mrd. EUR für den Konsum in 2001 wird ein Wert von 1181 Mrd. EUR angenommen
(roter Datenpunkt). Infolge der großen Hebelwirkung durch die weite Entfernung
des Ursprungs vom relevanten Bereich kommt es zu einem negativen autonomen
Konsum. Nach wie vor behielte Keynes' Feststellung, dass der Konsum mit dem
Einkommen steigt, allerdings schwächer als dieses, dennoch Gültigkeit.